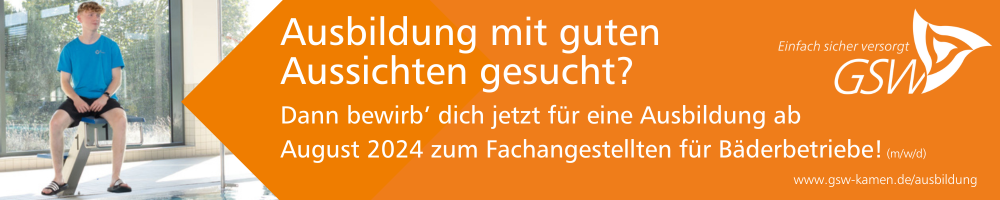Musikkritik: 2. Sinfoniekonzert: „Wunderkinder“ – Komponisten wie Solist und Dirigent
 von Dr. Götz Heinrich Loos
von Dr. Götz Heinrich Loos
Kamen. Unter oben genanntem Titel firmierte das 2. Konzert der Neuen Philharmonie Westfalen der Spielzeit 2016/17 am Mittwochabend in der Konzertaula. Und es waren einerseits die Komponisten, die hier gemeint waren: Mozart, Saint-Saens, Liszt und Korngold – andererseits passte es auch auf den Violoncello- Solisten István Várdai, der mit 12 Jahren in die Klasse der „außergewöhnlich Begabten“ an der Franz-Liszt-Musikakademie Budapest aufgenommen wurde; schließlich auch auf den jungen und munteren Dirigenten Constantin Trinks, der dieses Konzert als Gastdirigent leitete – bereits den großen Namen der Dirigentenszene in sehr jungen Jahren assistierend.
Das Programm war also ganz auf Wunderkinder ausgerichtet bzw. Werke, die aus ihrer jüngeren Zeit stammten oder die sie seit ihrer Jugend beschäftigt hatten (Liszt). Das Konzert startete mit der heiteren Sinfonie Nr. 31 D-Dur KV 297 Mozarts, der „Pariser“. Welch ein Gegensatz zwischen der Musik und der persönlichen Tragödie des Komponisten in jener Zeit: Krankheit und Tod der Mutter. Aber wie Roland Vesper im Einführungsvortrag betonte: Seine wahren Gefühle zeigen war damals nicht „en Vogue“; es galt die Wahrung der „Contenance“. So blieb der junge Mann in seinen Kompositionen bei persönlichem Schicksalsschlag in seiner gewohnten Vergnügtheit, beschwingt und leicht im Anschlag – sein Markenzeichen und mitunter doch etwas nervend. Die Interpretation dieser bewusst für ein „einfaches“ Publikum (Mozart hielt nicht viel von der Pariser Zuhörerschaft) geschriebenen Sinfonie war aber über jeden Zweifel erhaben: Gut, sie hätte etwas „historisch informierter“ herüberkommen können. Aber Constantin Trinks (hierbei ohne Taktstock) machte große Gesten in den Vorgaben und das Orchester folgte bestens, ob des Tempos nicht zu geschliffen, im Prinzip sehr angenehm. Trinks setzte auf die Betonung der Dynamiken, deutlich hervortretende Espressivi mit Exposition der einzelnen Orchestergruppen an entsprechenden Stellen, was sehr gut aufging. Neben den beiden Allegro-Sätzen war auch das Andante (mit dem Eingangsmotiv, das an die ersten Zeilen von „Kuckuck ruft’s aus dem Wald“ erinnert) nicht vernachlässigt worden in Sachen Dynamik und Ausdruck – wie aus einem Guss.
István Várdai legte dann bei Saint-Saens‘ Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 a-moll op. 33 sofort los – wie es in der Anlage vorgesehen ist. Von Anfang an überzeugte er nicht nur durch technische Perfektion, sondern ebenso durch ein klares und dennoch „gewürztes“ Spiel. Nun, wie soll man das näher beschreiben? Eine Ladung Emotionalität in einem transparenten Rahmen, wäre vielleicht eine Alternativdarstellung. Jedenfalls gelang ihm die Balance zwischen Ausdrucksfülle und Luftigkeit – nein, eigentlich die Synthese aus beidem. Eines jedenfalls sollte daraus ersichtlich werden: Mit Várdai war ein Meister seines Faches am Werk; er beherrschte das Werk von der ersten bis zur letzten Note. Mit dieser klassisch-romantischen „Mischung“ meisterte er auch Bachs Cello-Suite als Zugabe, freilich kaum in barockem Gewand, aber dennoch himmlisch schön.
Nach der Pause dann Liszts Sinfonisches Poem „Mazeppa“ nach Victor Hugo. Mit schnellem Tempo lenkte Trinks die Neue Philharmonie im ersten und hinteren Teilen dieses Werkes, das auf einer Etüde für Klavier fußte, die Liszt als Fünfzehnjähriger komponiert hatte, für diesen Stoff aber ihm wohl zu wenig, so dass er viele Jahre später daraus diese Sinfonische Dichtung machte. Eine Besonderheit ist das prachtvolle Hauptmotiv, das sich in festparadeartigem Tempo synchron über die Schnelligkeiten des ersten Teils erhebt. Hier waren die Blechbläser in Hochform. Überhaupt war die Interpretation sehr angemessen und gefällig. Die Volltönigkeit von Liszts Werk wurde in bester Praxis wiedergegeben und die kraftvollen Klänge waren von bestem spätromantischem Schmelz – abstrichlos. Amüsant zu sehen war es zudem, wie der große Ungar neben dem kleinen Deutschen (Dirigenten) den mächtigen Applaus empfing (er hätte noch mächtiger sein können – die Aula war wieder einmal beschämend leer); schließlich zog er Trinks auf das Podest neben sich, so dass sie fast in gleicher Augenhöhe waren.
Erich Wolfgang Korngold, in späten Jahren wegen seiner zahlreichen Hollywood-Soundtracks als „ernsthafter“ Komponist (was immer das auch sein mag!?) geschmäht, wird in der jüngeren Zeit hinsichtlich seiner „Nicht-Filmmusiken“ glücklicherweise stärker gewürdigt. Freilich – mit der bekannten Biografie und dem Vorwissen über ihn sucht man in jedem Werk jene Elemente, die typisch für Filmmusik sind. Aber man betrachte das Ganze einmal anders herum: Korngolds Musik war vorher schon so, dass sie späterhin als Filmmusik geeignet schien. Und so auch die Klänge in Korngolds Schauspiel-Ouvertüre für großes Orchester op. 4, das Werk eines Vierzehnjährigen! Als „schillernd“ wird Korngolds Tonsprache stets bezeichnet, was auch sehr treffend erscheint. Allerdings verkürzt dieser Begriff die Vielgestaltigkeit der verwendeten Elemente. Ohnehin ist man schier fassungslos, wenn man realisiert, dass eine solche Musik im Jahre 1911 entstanden ist – sie geht deutlich über Mahler hinaus, auch Strauss bringt nicht einen solchen – eben „schillernden“ – Reigen. Das Orchester machte daraus ein wahres Melodien-Feuerwerk; auch manches harmonische Wagnis bewusst betonend.
Ein sehr kurzweiliger Abend, so das Fazit, mit interessanten und sehr hörenswerten Werken, erneut in herausragenden Interpretationen.