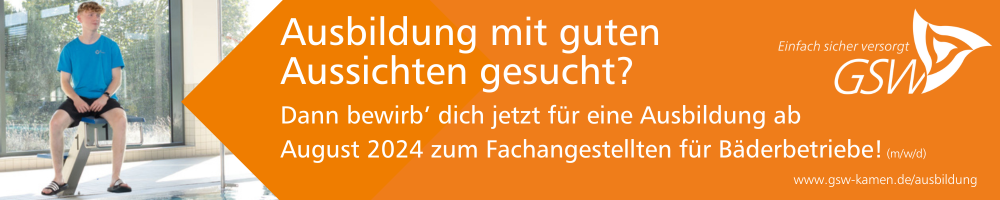Kamener Stadtpflanzen - Folge 44: Noch läutet der Mai
von Dr. Götz Loos
 Blühendes Maiglöckchen am GartenplatzKamen. Der Juli ist schon in Sichtweite, doch noch immer blühen die Maiglöckchen (Convallaria majalis) mit ihren letzten Blüten in der Stadt. Ein beliebtes Gewächs, vielmehr seine Blüten, in und aus Kultur war diese auch (unter anderen) als Maiblume oder Maienblümchen bezeichnete Pflanze immer schon, aber genauso gehört sie zu den einheimischen Gewächsen unserer Wälder, wohin sie aber zusätzlich durch Verschleppung mit Gartenabfällen hingelangt. Gut entwickelte Humusböden (Mulle) werden unter natürlichen Bedingungen bevorzugt, die Gartenpflanzungen und ihr gutes Gedeihen zeigen jedoch, dass die Art anspruchsloser sein kann als gedacht.
Blühendes Maiglöckchen am GartenplatzKamen. Der Juli ist schon in Sichtweite, doch noch immer blühen die Maiglöckchen (Convallaria majalis) mit ihren letzten Blüten in der Stadt. Ein beliebtes Gewächs, vielmehr seine Blüten, in und aus Kultur war diese auch (unter anderen) als Maiblume oder Maienblümchen bezeichnete Pflanze immer schon, aber genauso gehört sie zu den einheimischen Gewächsen unserer Wälder, wohin sie aber zusätzlich durch Verschleppung mit Gartenabfällen hingelangt. Gut entwickelte Humusböden (Mulle) werden unter natürlichen Bedingungen bevorzugt, die Gartenpflanzungen und ihr gutes Gedeihen zeigen jedoch, dass die Art anspruchsloser sein kann als gedacht. Maiglöckchen sind als Zierpflanzen sehr beliebt, aber Viele schrecken davor zurück, sie im eigenen Garten zu pflanzen. Grund dafür sind die unterirdischen Erdsprosse, mit denen diese "späte" Frühlingspflanze sich ungeschlechtlich ungehemmt in alle Richtungen von der Pflanzstelle herrührend ausbreiten kann. Die dabei aufgebauten Bestände sind so dicht, dass sie kaum einer Art dazwischen Platz lässt, auch wenn das Maiglöckchen an sich niedrigwüchsig ist. Als Bodendecker ist es bis in schattige Gehölzbereiche hinein geeignet (tiefschattig freilich kaum blühend), die zügellose Flächeneinnahme kann jedoch im Garten störend sein - so landet dann die Art im Gartenmüll und allzu oft in Gehölzen, in denen sie ursprünglich nicht vorkam. Wer sie auf den Komposthaufen wirft, weiß um ihre Wüchsigkeit; selbst hier und selbst bei freiliegenden Erdsprossen und Wurzeln vermag sie anzuwachsen.
Deshalb wird das Maiglöckchen insgesamt lieber in Sträußen gekauft. Nichtsdestotrotz ist sie in den Gärten im Kamener Siedlungsbereich Mitte verbreitet gepflanzt zu finden, in den Gärten und Vorgärten bürgert es sich schnell und praktisch überall, wo Pflanzungen bestehen, ein. Und dann wird es zum "Ausbrecher": durch Zäune wachsend, in Pflaster- und Randsteinfugen von Beeten her eindringend, sogar unter Mauern hindurch. Und weiterhin in den Siedlungsgehölzen und auf Brachen taucht es auf - entweder ausbrechend aus benachbarten Gärten oder eben mit illegal entsorgten Gartenabfällen. Trockene Standorte erträgt es problemlos, feuchtere nicht minder, solange es keine nassen "Füße" bekommt.
 Auf dem Spiek: Maiglöckchen haben durch ungeschlechtliche Vermehrung das Beet übernommenVielleicht wurde das Maiglöckchen ursprünglich als Heilpflanze in die Gärten gebracht. Doch hierbei ist mit Vorsicht zu walten: Die Wirkung der herzwirksamen Glykoside kann schnell ins Gegenteil verkehrt werden und bis hin zum Herztod führen. So ist das beliebte Gewächs als sehr giftig einzustufen. Eine Verwechslung mit dem Bär-Lauch (Allium ursinum) ist eigentlich kaum möglich - schon aufgrund des allzeit knoblauchig-würzigen Duftes, der sich spätestens beim Zerreiben der Blätter des Bär-Lauches ergibt, während die Blätter des Maiglöckchens niemals nach irgendetwas riechen. Dennoch werden immer wieder Vergiftungsfälle wegen Verwechslung bekannt. Der allgemeine Rat kann nur lauten: Ohne sichere Kenntnisse Finger weg! Pikant ist es nur, wenn beide Arten durcheinander vorkommen, so eingebürgert mit weiteter Ausbreitung nebeneinander in einem kirchlichen Garten in Kamen-Mitte.
Auf dem Spiek: Maiglöckchen haben durch ungeschlechtliche Vermehrung das Beet übernommenVielleicht wurde das Maiglöckchen ursprünglich als Heilpflanze in die Gärten gebracht. Doch hierbei ist mit Vorsicht zu walten: Die Wirkung der herzwirksamen Glykoside kann schnell ins Gegenteil verkehrt werden und bis hin zum Herztod führen. So ist das beliebte Gewächs als sehr giftig einzustufen. Eine Verwechslung mit dem Bär-Lauch (Allium ursinum) ist eigentlich kaum möglich - schon aufgrund des allzeit knoblauchig-würzigen Duftes, der sich spätestens beim Zerreiben der Blätter des Bär-Lauches ergibt, während die Blätter des Maiglöckchens niemals nach irgendetwas riechen. Dennoch werden immer wieder Vergiftungsfälle wegen Verwechslung bekannt. Der allgemeine Rat kann nur lauten: Ohne sichere Kenntnisse Finger weg! Pikant ist es nur, wenn beide Arten durcheinander vorkommen, so eingebürgert mit weiteter Ausbreitung nebeneinander in einem kirchlichen Garten in Kamen-Mitte.Maiglöckchen und Bär-Lauch sind beide einkeimblättrige Gewächse mit langgezogenen Grundblättern mit parallel zueinander verlaufenden Blattnerven. Da hören die Gemeinsamkeiten jedoch bereits auf: Maiglöckchen blüht bei uns von frühestens Ende März (meist aber April) bis spätestens Anfang Juli (Bär-Lauch beginnt deutlich früher und endet früher). Und beim "echten" Frühblüher verwelken die oberirdischen Teile des Bär-Lauches (momentan gut sichtbar), während nach der Blüte die Blätter des Maiglöckchens dauernd stehenbleiben.
Die einmal breiter ausfallenden, einmal etwas schmaleren lanzettlichen, dunkelgrünen, oft etwas blaugrün angelaufenen Blätter stehen grundständig meist zu zweit, weniger oft zu dritt und geben der höchstens 30 cm hohen Maiglöckchenpflanze das charakteristische Aussehen. Der Stängel selbst weist keine weiteren Blätter auf, an seinem oberen Ende bildet sich ein schließlich bogig überhängender Blütenstand, an dem sich üblicherweise weiße glockige Blüten entwickeln, an denen am Ende sechs freie Zipfel ausgebildet sind, während der größere Teil der Blütenhülle verwachsen ist. Der betörende Duft ist ein beliebter Parfümbestandteil; Weiteres hierzu siehe z.B. im einschlägigen Wikipedia-Beitrag.
Nach dem Abblühen bilden sich rote rundliche Beeren, welche vorwiegend der Ausbreitung durch Vögel (insbesondere Amseln) dienen. Unterschiede in Blattlänge und -breite ergeben sich als Modifikationen durch die jeweiligen Standortbedingungen, können daneben aber auch erbfest sein und Ausdruck von lokalen Klonbildungen (sehr breitblättrige Gartentypen wurden zuvor von Gärtnern ausgelesen und vermehrt). Erbfeste Fixierung von Merkmalsausprägungen kann durch Selbstbefruchtung erfolgen, die auftritt, obwohl die Pflanze quasi alles tut, um Fremdbefruchtung durch Insekten zu gewährleisten (Staubbeutel öffnen sich vor den Narben; Heterostylie, d.h. verschieden lange Griffel).
 Überhängender Maiglöckchen-Blütenstand mit den typischen weißen Glöckchen-Blüten
Überhängender Maiglöckchen-Blütenstand mit den typischen weißen Glöckchen-Blüten