Eisvogel, Prachtlibelle und Kiebitz mit dem Smartphone auf der Spur: Naturgucker-App macht Artenvielfalt in der Emscher-Lippe-Region sichtbar
Geschrieben von Redaktion am . Veröffentlicht in Natur & Umwelt
 Wer mit offenen Augen durch die Natur läuft, kann viele Tiere, wie zum Beispiel den Kiebitz, beobachten und diese Entdeckungen nun auch mittels der WebApp „Naturgucker“ dokumentieren - wichtige Daten, die so auch für die Forschung genutzt werden können. © Bernd Stemmer/EGLVEmscher-Lippe-Region. In der Emscher-Lippe-Region erwacht dank renaturierter Flüsse eine Artenvielfalt, wie sie lange nicht mehr beobachtet wurde. Darunter befinden sich auch einige Tiere, die auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen. Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, kann viele dieser Tiere und Pflanzen beobachten. Und wer dabei sein Smartphone griffbereit hat, kann diese Entdeckungen nun auch mittels der WebApp "Naturgucker" festhalten und gleichzeitig den Forschern vom Naturschutzbund Nordrhein-Westfalen (NABU NRW) sowie von Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) viel über die Verbreitung einzelner Arten verraten.
Wer mit offenen Augen durch die Natur läuft, kann viele Tiere, wie zum Beispiel den Kiebitz, beobachten und diese Entdeckungen nun auch mittels der WebApp „Naturgucker“ dokumentieren - wichtige Daten, die so auch für die Forschung genutzt werden können. © Bernd Stemmer/EGLVEmscher-Lippe-Region. In der Emscher-Lippe-Region erwacht dank renaturierter Flüsse eine Artenvielfalt, wie sie lange nicht mehr beobachtet wurde. Darunter befinden sich auch einige Tiere, die auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen. Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, kann viele dieser Tiere und Pflanzen beobachten. Und wer dabei sein Smartphone griffbereit hat, kann diese Entdeckungen nun auch mittels der WebApp "Naturgucker" festhalten und gleichzeitig den Forschern vom Naturschutzbund Nordrhein-Westfalen (NABU NRW) sowie von Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) viel über die Verbreitung einzelner Arten verraten.
Der Kiebitz, Vogel des Jahres 2024, kann zum Beispiel jetzt wieder beobachtet werden. Im März fängt er an, seine Nester auf gehölzarmen Feuchtwiesen zu bauen. Aufgrund von Entwässerungen und intensiver Flächennutzung ist er heute stark gefährdet und steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten. In renaturierten Auenlandschaften findet er jedoch wieder geeignete, naturnahe und vor allem geschützte Lebensräume. So konnte er bereits an einigen Hochwasser-Retentionsräumen entlang der Emscher gesichtet werden. Auch die Gebänderte Prachtlibelle findet an künstlich mit Steinen und Beton befestigten Ufern keinen Lebensraum. An sonnigen Ufern renaturierter Gewässerläufe kann sie jedoch ab April entdeckt werden. Ebenso der kleine Eisvogel mit seinem markant blauschimmernden Gefieder, der sich in dieser Jahreszeit gerne in den Ufergehölzen fischreicher Gewässer auf der Suche nach Nahrung findet.
Bei Naturgucker teilen die Experten von NABU und EGLV solche Tipps. Es werden verschiedene Tier- und Pflanzenarten in der WebApp vorgestellt, mit ihren Eigenheiten, Lebensräumen und den besten Beobachtungszeiten. Naturinteressierte können hier nachlesen, Fotos ihrer Entdeckungen hochladen und sich mit vielen Gleichgesinnten austauschen. In der WebApp erhalten sie auch Hilfe, um die fotografierten Arten zu bestimmen.
Bei allen Beobachtungen, die bei Naturgucker hochgeladen werden, wird der Standort der Entdeckung markiert. So entsteht nach und nach eine Datenbank über die Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten in der Emscher-Lippe-Region. Auch die Rückkehr von Arten, die dieses Gebiet lange gemieden haben, wird dank der Mithilfe der Bürger so schneller erfasst. Damit geben die gesammelten Daten auch Auskunft über die Wirksamkeit der Renaturierungs- und Artenschutzmaßnahmen von Emschergenossenschaft und Lippeverband oder verraten, wo die Natur noch weitere Unterstützung benötigt.
Die WebApp Naturgucker ist kostenlos. Sie ist im Internet ohne Download unter NABU-naturgucker.de/eglv zu finden.

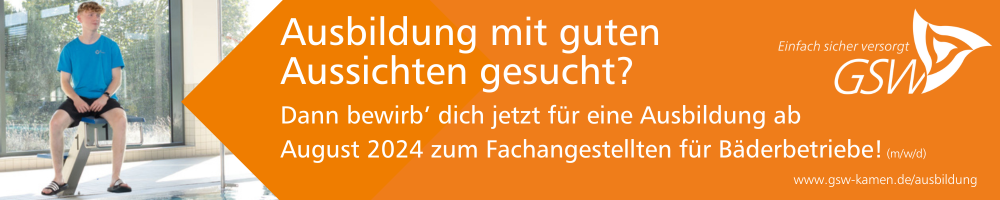
 Kamen-Heeren-Werve. Am Samstag, den 24. Februar, lädt das Stadtteilmanagement Heeren-Werve in Zusammenarbeit mit der Stadt Kamen und dem Lippeverband alle Interessierten zu einem Workshop über die Grundlagen der Obstbaumpflege ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr auf der Streuobstwiese in Kamen Heeren-Werve.
Kamen-Heeren-Werve. Am Samstag, den 24. Februar, lädt das Stadtteilmanagement Heeren-Werve in Zusammenarbeit mit der Stadt Kamen und dem Lippeverband alle Interessierten zu einem Workshop über die Grundlagen der Obstbaumpflege ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr auf der Streuobstwiese in Kamen Heeren-Werve.




