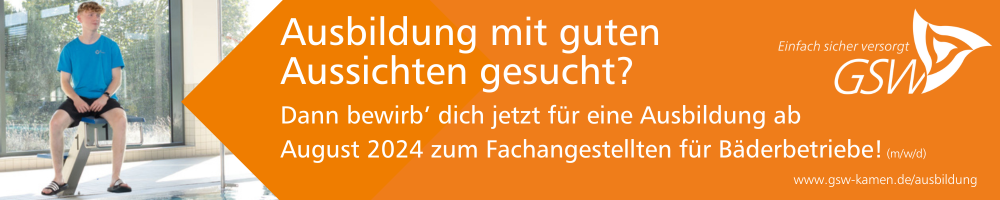Breitblättrige Traubenhyazinthen mit Selbstaussaat im Schulgarten des Gymnasiums
Breitblättrige Traubenhyazinthen mit Selbstaussaat im Schulgarten des Gymnasiums
von Dr. Götz Loos
 Teils selbst ausgesäte Breitblättrige Traubenhyazinthen (teilweise neben Armenischen Traubenhyazinthen) an der Hammer StraßeGeradezu allerorten im Siedlungsbereich blühen die Armenischen Traubenhyazinthen (Muscari armeniacum) mit ihren ziemlich einheitlich blauen Blüten - eine der am häufigsten verwilderten Zierpflanzen, der schon ein Porträt in dieser Reihe gewidmet war. Von Jahr zu Jahr breitet sich diese Art mehr aus, auch bereits unabhängig von Pflanzungen.
Teils selbst ausgesäte Breitblättrige Traubenhyazinthen (teilweise neben Armenischen Traubenhyazinthen) an der Hammer StraßeGeradezu allerorten im Siedlungsbereich blühen die Armenischen Traubenhyazinthen (Muscari armeniacum) mit ihren ziemlich einheitlich blauen Blüten - eine der am häufigsten verwilderten Zierpflanzen, der schon ein Porträt in dieser Reihe gewidmet war. Von Jahr zu Jahr breitet sich diese Art mehr aus, auch bereits unabhängig von Pflanzungen.
Eine verwandte, jedoch etwas später aufblühende Art ist die Breitblättrige Traubenhyazinthe (Muscari latifolium). Sie fällt durch Zweifarbigkeit im Blütenstand auf: Die oberen Blüten(-Hüllen) sind kräftig blau, die unteren schwarzviolett, mehr oder weniger blaustichig. Auch hat sie nicht die zahlreichen, zur Blütezeit meist schlaff hängenden bis liegenden, mehr oder weniger schmalen Blattspreiten der Armenischen Traubenhyazinthe, sondern ein bis zwei starre, breite Blätter.
Aus der Türkei stammend, wird die Breitblättrige Traubenhyazinthe genau wie die Armenische als Zierpflanze kultiviert, nur erheblich seltener. Zwar hat sie etwas im Anbau zugenommen, kann aber längst nicht als häufig bezeichnet werden. Umso bemerkenswerter erscheint, dass sie sich schnell ausbreitet, scheinbar auch aus Samen, nicht nur durch Abteilung von Tochterzwiebeln, denn selbständig aufkommende Tochterpflanzen der kultivierten Exemplare stehen mitunter in deutlichem Abstand zu diesen.
Die erste derartige Verwilderung beobachtete ich bereits vor einigen Jahren auf dem evangelischen Friedhof in Methler. Im Siedlungsgebiet Mitte fand ich erst sehr wenige Vorkommen mit Vermehrung. Tatsächlich ist dies allerdings an nahezu allen Pflanzstellen der Fall, wenn die Art nicht gerade eben erst eingesetzt wurde.
Der Begriff: Zwiebel
Beim Begriff Zwiebel denkt man zunächst einmal an die in der Küche verarbeiteten Zwiebeln. Aber der Begriff "Blumenzwiebel" ist freilich auch bekannt. Die Breitblättrige Traubenhyazinthe gehört zu den frühblühenden "Zwiebelblumen" - so wie Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Blausterne, Schneeglöckchen etc. etc.
Zwiebeln sind gestauchte, unterirdische Sprossabschnitte, die im Umriss herzförmig, rundlich oder länglich sind. Außen schützt die häutige, meist trockene Zwiebelschale die Zwiebel vor Austrocknung. Im Inneren befindet sich die so genannte Zwiebelscheibe, an der fleischige, besondere Blätter, die Niederblätter sitzen, welche um die Scheibe angeordnet sind.
Diese Blätter dienen als Speicherorgane, mit denen die jeweilige Pflanzenart die ungünstigen Jahreszeiten überlebt. Da viele Zwiebelpflanzen in Gehölzen wachsen, ist damit die Zeit gemeint, in der die Blätter der Bäume und Sträucher voll entwickelt sind und den Boden beschatten. Nur wenn im Frühjahr die Blätter der Holzgewächse noch fehlen, können sich oberirdische Sprosse entwickeln, die Pflanzen blühen und fruchten. Wird es schattiger, verwelken die oberirdischen Teile meistens und sterben ab. Die Zwiebeln sorgen für das Überdauern der Pflanzen bis zum nächsten Frühjahr bzw. Vorfrühling. Damit zählen die meisten Zwiebelpflanzen zu den Frühblühern (Frühjahrsgeophyten), die alle ähnliche Lebensstrategien besitzen.
 Echte Nelkenwurz (Geum urbanum) vor der Wand der Turnhalle des GymnasiumsKamen. Tatsächlich trägt die Echte Nelkenwurz die Stadt im Namen, aber zunächst im wissenschaftlichen: Geum urbanum - "urbanum" kommt vom lateinischen "urbs", Stadt. Deshalb spricht man alternativ auch von der Stadt-Nelkenwurz. Aber eine Stadtpflanze im engeren Sinne, also Bewohner von Extremstandorten (insbesondere Trockenheit), ist sie nicht. Oder vielmehr: War sie nicht!
Echte Nelkenwurz (Geum urbanum) vor der Wand der Turnhalle des GymnasiumsKamen. Tatsächlich trägt die Echte Nelkenwurz die Stadt im Namen, aber zunächst im wissenschaftlichen: Geum urbanum - "urbanum" kommt vom lateinischen "urbs", Stadt. Deshalb spricht man alternativ auch von der Stadt-Nelkenwurz. Aber eine Stadtpflanze im engeren Sinne, also Bewohner von Extremstandorten (insbesondere Trockenheit), ist sie nicht. Oder vielmehr: War sie nicht!